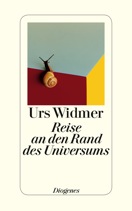Momente, die bewegen und Momente zum Geniessen
200-Jahr-Jubiläum von «Stille Nacht! - Heilige Nacht!»

«Stille Nacht!» - ein zauberhaftes und schönes Lied geht um die Welt.
(Foto: Archiv)
Nach Placido Domingo wäre dieses Werk das ideale Welt-Friedenslied
Am 24. Dezember 1818 erklingt in der Schifferkirche St. Nikolaus in Oberndorf bei Salzburg erstmals das heute weltweit bekannteste Weihnachtslied „Stille Nacht! - Heilige Nacht!“. Etwa zweieinhalb bis drei Milliarden Menschen rund um den Globus kennen das Lied, auf der Südseeinsel Samoa genauso, wie bei den Innuit in der Arktis. Es ist damit auch das global bekannteste Musikstück. Eine faszinierende Geschichte, geschmückt mit zahlreichen Legenden: Gaben letztlich Mäuse und eine defekte Orgel in Oberndorf den Ausschlag für diese Komposition – die bis heute in mehr als 300 Sprachen und Dialekte übersetzt wurde? Allein Bing Crosby und Mahalia Jackson verkauften Tonträger von «Stille Nacht!» in zweistelliger Millionenhöhe, Bing Crosby allein etwa 30 Millionen. Eine spannende, umfassende geschichtliche Abhandlung von Dr. Hans Reis exklusiv bei Kulturonline.ch.
«Ich denke, 'Stille Nacht!, Heilige Nacht!' wäre als das Welt-Friedenslied prädestiniert wie kaum ein anderes Lied auf dieser Erde!» (Placido Domingo)
«Stille Nacht!»-Lieder von verschiedenen Interpreten (You tube Überblick).
Faszinierende Szene aus dem Dokomentarfilm «Stille Nacht!» - Ein Lied für die Welt mit Lina Makhoul.
Mehr zur Sängerin Lina Makhoul.
Wir schreiben das Jahr 1818. Viele Teile Europas leiden unter den Folgen der Kriege, mit denen Napoleon den Kontinent von 1792 bis 1815 überzogen hat. Diese sind zu Ende, Napoleon am 18. Juni 1815 im belgischen Waterloo – Synonym für eine endgültige Niederlage – definitiv besiegt.Europa erlebt auf dem Wiener Kongress im gleichen Jahr eine Neuordnung.Auch Salzburg, Tirol und Oberösterreich sind davon betroffen. Im Zuge dieser Ereignisse erfährt das geistliche Fürstentum Salzburg, das seine Selbständigkeit verloren hatte, die Säkularisierung. Ein Teil Salzburgs kommt 1816 zu Bayern, der grössere Teil aber zum kaiserlichen Österreich.
Die Menschen sind bettelarm
Als globaler Grund für die miserable Situation kommt nebst den «hausgemachten» europäischen Kriegsfolgen der Ausbruch des Vulkans Tambora hinzu, der grösste von Menschen bisher dokumentierte Vulkanausbruch – für Fachleute ein Jahrtausendereignis. Am 5. April 1815 schleudert dieser auf der kleinen indonesischen Insel Sumbawa etwa 150 Kubikkilometer Massebis in die Stratosphäre, auf über 30 km Höhe, und diese Mikropartikel (Russ, Sulfat Aerosole etc.) reflektieren das Sonnenlicht. Auch über Europa verdunkelt sich als Folge der Eruption der Himmel. In Mitteleuropa und Nordostamerika hat das Jahr 1816 gerade zum Frühling angesetzt, da kehrt der Schnee zurück. Die Kälte bleibt. In Österreich, Baden-Württemberg aber auch in der Schweiz regnet oder schneit es über Monate.
Johann Wolfgang von Goethe schreibt am 29. Juni 1816 in sein Tagebuch: «Erstmals etwas Sonne …». «Der Sommer 1816 war nicht nur der Sommer ohne Sonne, sondern effektiv ein Schneesommer. Die Temperaturen lagen durchwegs bei - 2°C bis -3°C, auch in der Schweiz», so der ehemalige Wetterfrosch von Radio SRF, Mario Slongo, «das bei damals üblicherweise 13°C -15°C für Juni bis August (z.B. für die Station Zürich-Fluntern)». Zusätzliches Pech: Der Tambora bricht gerade nach einer Periode mit niedriger Leuchtkraft der Sonne aus (Dalton-Minimum 1808-1813), was bereits zu kälteren Jahreszeiten geführt hatte.
Auf Tauwetter folgen später extreme Hochwasser
Die Getreidepreise vervielfachen sich, Armeessen vor Hunger Gras. Bäcker backen spezielle Hungerbrötchen, die mit Gipspulver, Eichel- oder Sägemehl gestreckt sind. Bis 1817 habe es kaum Ernten gegeben, sagt Claus-Peter Hutter, Leiter der Akademie für Natur- und Umweltschutz in Baden-Württemberg. «Die Menschen haben ihre Zugtiere geschlachtet und die Saatkartoffeln in ihrer Not wieder ausgegraben». Die schlimmste Hungersnot des 19. Jahrhunderts in unseren Breitengraden nimmt ihren Lauf. Mary Shelley soll ihren Roman «Frankenstein» geschrieben haben, weil sie wegen des vielen Regens ihr Haus in der Nähe des Genfersees kaum verlassen konnte. Dort war sie zu Gast.
In Europa verhungern unzählige Menschen oder wandern aus, weil auf den Feldern kaum etwas wächst, die mageren Ernten im Dauerregen vermodern, und das Vieh verendet. In Salzburg sinkt die Bevölkerung in elf Jahren von knapp 12 700 (1805) auf rund 8 000 (1816) Einwohner. Bereits 1805 leben dort 1 900 (15 %) von Almosen, wie Friedrich Graf Spaur berichtet.
Ein Blick in schwierigen Zeiten nach Oberndorf
 Oberndorf um 1890 mit der St. Nikolaus-Kirche, wo die Uraufführung von «Stille Nacht!» stattfand. Diese Kirche wurde wegen Hochwasserschäden einige Jahre später abgerissen.
Oberndorf um 1890 mit der St. Nikolaus-Kirche, wo die Uraufführung von «Stille Nacht!» stattfand. Diese Kirche wurde wegen Hochwasserschäden einige Jahre später abgerissen.
Oberndorf, etwa 20 km nördlich von Salzburg gelegen, das zur Gemeinde Laufen gehört, ist von all dem keine Ausnahme. Der Ort selbst liegt an der Grenze zwischen Bayern und Österreich, wird mal dem einen, mal dem anderen Teil zugeschlagen, vom Stadtzentrum Laufen getrennt (heute Bayern), da der Fluss Salzach zur Staatsgrenze wird. Familien werden auseinandergerissen, ebenso Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Zur generell misslichen Lage noch das: Die Salzschifffahrt kommt wegen der ständigen Konflikte und der sinkenden Nachfrage zum Erliegen. Schiffer, Schiffbauer und damit der ganze Ort gehen unsicheren Zeiten entgegen. Hoffnungslosigkeit und die Sehnsucht nach besseren Zeiten machen sich breit.
Der Salztransport auf der Salzach von Hallein und Bad Reichenhall (Berchtesgaden) bildete über Jahrhunderte die Grundlage für den Wohlstand in Laufen/Oberndorf. Denn in Oberndorf befindet sich vor der grossen Schlaufe der Salzach – fast 180 Grad – seit Urzeit ein riesiger Nocken (Fels) – heute gesprengt –, der das Durchkommen der Schiffe verunmöglicht. Das Salz wird folglich abgeladen, z.T. zwischengelagert und auf andere, grössere Schiffe, sogenannte Plätten, verladen und weiter Richtung Inn, Donau bis ans Schwarze Meer transportiert. Mit der Eisenbahn (1860) verschwindet dieser Salztransport dann komplett.
«Weyhnachten» 1818 naht
Das Schicksal will es, dass in dieser trostlosen Zeit im arg gebeutelten Oberndorf zwei Menschen zusammenkommen, sozusagen in der geografischen Mitte ihrer Geburtsorte – Salzburg und Hochburg, nahe dem bayerischen Burghausen – und so das Lied «Stille Nacht!» entsteht. Joseph Mohr, 26jährig, beginnt 1817 für zwei Jahre seinen Dienst als Hilfspriester in Oberndorf, in der neu errichteten «Pfarre» (Pfarrei) St. Nikolaus mit der gleichnamigen Schifferkirche. Nikolaus ist der Schutzpatron der Schiffer, deshalb dieser Name. Franz Xaver Gruber, 31jährig, ist Lehrer im wenige Kilometer entfernten Armsdorf, aber auch «Organist» in der Oberndorfer Kirche. Arnsdorf, wie es sich heute schreibt und etwa 700 Einwohner zählt, gehörte immer zum benachbarten Lamprechtshausen, war nie eine eigene politische Gemeinde.
Mohr und Gruber verbinden zwei Dinge, der Glaube und das Talent für die Musik. In Oberndorf freundet sich Mohr mit Gruber an, auch weil Mohr in Gruber eine fast väterliche Stütze sieht, trotz nur fünf Jahren Altersunterschied.
Es ist Adventszeit, und das Weihnachtfest 1818 naht. Die Leute sehnen sich nach Licht und Wärme in der Tristesse des Alltags. Mohr sucht am 24. Dezember 1818 Gruber auf und bittet ihn, ein Gedicht zu vertonen, das Gedicht: «Stille Nacht! - Heilige Nacht!». Er hatte dieses, wie heute zweifelsfrei feststeht, bereits 1816 an seinem damaligen Wirkungsort Mariapfarr im (südlichen) Salzburger Bezirk Lungau geschrieben, damals etwa drei bis vier Tagesreisen (140 km) von Oberndorf entfernt. Mariapfarr hatte sehr unter den bayerischen Besatzungstruppen zu leiden.
Gruber komponiert am 24. Dezember 1818 die Melodie des „Weyhnachtslieds“, wie «Stille Nacht!» damals genannt wird in D-Dur für zwei (Sing-)Solo-Stimmen und Gitarrenbegleitung. Noch am selben Abend wird das Lied am Ende der «Christmette», der Mitternachtsmesse, von Mohr und Gruber zum ersten Mal gesungen. Mohr singt die Tenorstimme, begleitet mit der Gitarre, und Gruber singt die Bassstimme. Max Gurtner, Kustos des «Stille-Nacht!»-Museums im Arnsdorfer Schulhaus, wo Gruber im Parterre unterrichtete, ist überzeugt, dass das Lied nicht Teil der Liturgie war, sondern nach der Christmette gesungen und die Gitarrenbegleitung deshalb nicht als «anstössig» empfunden wurde. Dem schliessen sich auch andere Kenner der «Stille-Nacht!»-Geschichte an, zum Beispiel Josef A. Standl, Chefredakteur a.D. und «Stille-Nacht!»-Koordinator der Stadt Oberndorf.
Komponist Gruber ist über das Werk und die Gitarrenbegleitung erfreut, auch wenn er es später als eine Gelegenheitskomposition betrachtet und ihr nicht allzu viel Bedeutung beimisst. Allerdings hält er fest: «Die Ergriffenheit derer, die an der Messe teilgenommen haben, war eine echte». Gruber und Mohr gehen später örtlich getrennte Wege. Gruber komponiert zum Abschied Mohrs von Oberndorf für ihn ein spezielles Musikstück, und auch ihr Lied «Stille Nacht!» erlebt eine Wanderschaft, und die Autoren geraten allmählich in Vergessenheit.

Blick von Oberndorf über die Salzach nach Laufen (heute Bayern D).
Legenden mangels Fakten
Hartnäckighält sich in verschiedenen Beschreibungen die Vermutung oder Behauptung, während diesen Weihnachtstagen sei die Orgel in der St.-Nikolaus-Kirche Oberndorf defekt gewesen. Und:Mäuse hätten den ledernen Blasbalg des Instruments angefressen, weshalb dieses nicht mehr funktionierte.Kam Mohr gerade deswegen an diesem 24. Dezember 1818 zu Gruber und bittet um Vertonung? Hat ihn allenfalls Gruber in der Not gerufen, weil die Orgel nicht funktionierte und er nach einer Alternative sucht? Hätte ja sein können. Oder: Mangels Orgel die Gitarrenbegleitung – ausgerechnet einesKirchenlieds?
Heute weiss man, dass die «Orgelgeschichte» – gemäss jetzigem Verständnis einer Orgel – so nicht stimmt, denn die St.-Nikolaus-Kirche bekam erst 1825 eine richtige Orgel. Wohl hatten sie ein sogenanntes Positiv, eine kleines, leicht versetzbares und tragbares Pfeifeninstrument mit wenigen Registern, vermutlich einmanualig und ohne (oder nur mit angehängtem) Pedal. Zu seiner Bedienung war vor der Einführung elektrischer Gebläse neben dem Organisten ein Kalkant für die Bedienung des Blasbalgs erforderlich, sofern nicht der Organist – ähnlich wie beim Harmonium – diesen selbst mit den Füssen bedienen konnte. Ob dieses Positiv bei der Entstehung von «Stille Nacht!» wirklich eine Rolle spielte, darüber gehen die Meinungen trotz akribischer Forschung auseinander. Gurtner verneint das mit Vehemenz. Standl, aber auch andere Forscher wie Thomas Hochradner,Prof. für Historische Musikwissenschaft an der Universität Mozarteum(Salzburg)relativieren und schliessen es nicht kategorisch aus. Fest steht, dass dieses Positiv für die grosse Kirche zu schwach war. Welche Rolle es für die Entstehung von „Stille Nacht!“ wirklich spielte, wird man wohl kaum je mit Gewissheit erfahren.
Definitiv ins Reich der Legenden gehört die «Mäusegeschichte». Darüber herrscht bei allen Kennern Konsens. Sie taucht auch erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg auf, damals von einer amerikanischen Journalistin in die Welt gesetzt und wohl hundert-, wenn nicht tausendfach kolportiert. Standl etwas lakonisch: «Ob sich die Journalistin wohl von ‚Micky Mouse‘ inspirierenliess?»
Um die Entstehung von „Stille Nacht!“ haben sich deshalb zahlreiche Legenden gebildet, weil weder Berichte der Autoren selber noch solche von Zeitzeugen vorhanden sind, die über die Entstehung und vor allem die Motive der Komposition Auskunft geben. Was die Gitarrenbegleitung betrifft, verweisen manche Musikkenner auf die Jahreszahl 1818, auf die Anfänge der Romantik. Eine Gitarrenbegleitung eines Liedes, das zu Herzen gehen soll, sei damals nichts Ungewöhnliches gewesen, monieren sie, auch wenn es während der Liturgie aber wohl eher als Fremdkörper gegolten hätte.
Selbst die Urschrift, also die Originalfassung der Komposition fehlt (bis heute). So ist man im Wesentlichen auf die späteren Autographe, also die eigenhändigen Niederschriften der Komposition durch Mohr und/oder Gruber selber, oder die Abschriften Dritter angewiesen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstehen vorerst mehrere, etwa von Blasius Wimmer (1819), Johann Baptist Weindl (1822) und Johann Reinhartshuber (1826). Weitere, zwischen 1840 und 1860 entstehende stammen in der Regel von Lehrern und Organisten aus dem regionalen Raum. Hochradner, der wie Standl und Gurtner grosse Verdienste um die wissenschaftlich erhärtete Entstehungsgeschichte von «Stille Nacht» hat, schreibt, «dass sich die frühe Überlieferung von ‚Stille Nacht‘ wesentlich in der Fassung verbreitete, die Franz Xaver Gruber in seinen Autographen notiert hat.»
Vom Zillertal nach Europa und in die weite Welt
Dass das Lied den Weg aus dem Tiroler Zillertal in die weite Welt findet ist mehreren Glücks- und Zufällen zu verdanken. Gruber steht mit dem Orgelbaumeister Karl Mauracher aus Fügen in Kontakt und zwar seit der Reparatur der Arnsdorfer Orgel (1819). Mauracher hört von der Melodie, lässt sich vom Organisten Gruber die Noten geben und bringt das Lied nach Fügen. Dort interessieren sich die sogenannten «Tiroler Sängergesellschaften» dafür, u. a. die Geschwister Rainer. Diese singen im Kirchenchor von Fügen. Bereits ein Jahr nach der Komposition, an Weihnachten 1819, ertönt dort «Stille Nacht!» in der «Christmette». Drei Jahre später sollen es die Rainer-Sänger dem Habsburger Kaiser Franz I. und dem russischen Zar Alexander I. im Kaiserzimmer im Schloss Fügen vorgesungen haben. Das steht in etlichen Quellen, ist nach Gurtner (und anderen Kennern) aber Legende: «Sie sangen vor Kaiser und Zar Lieder, man kennt die Titel (Archiv in Innsbruck). “Stille Nacht!“ war aber nicht dabei.»
Die Rainer-Sänger geben das Lied an die Geschwister Strasser weiter – eigentlich eine Handschuhmacher-Familie –, welche mit ihren Konzerten europaweit ein «Zubrot» verdient. Sie singen Tiroler Lieder und damit auch «Stille Nacht!». In Leipzig führt die Familie um 1830 ein Weihnachtskonzert auf mit dem Lied aus Oberndorf. Die Zuhörer sind so begeistert, dass sie die Familie gleich für das nächste Jahr wieder buchen, mit der Auflage allerdings, «das neue Weihnachtslied wieder zu singen».
Eine weitere Tiroler Familie nimmt das Lied sogar für Auftritte in Amerika und vor der englischen Königsfamilie mit. 1839 singen, so vermutete man heute, die Rainer-Sänger das Lied vor der Holy-Trinity-Church in New York erstmals in den USA. Der Erfolg ist überall der gleiche und 20 Jahre später ist «Stille Nacht! - Heilige Nacht» bereits ein weit herum bekanntes Weihnachtslied.
Kurz nach dem Auftritt der Geschwister Strasser erscheint bei A. R. Friese in Dresden 1833 der Erstdruck des Liedes und zwar auf einem Flugblatt unter dem Titel «Vier ächte Tyrolerlieder», gemeinsam mit drei anderen «ächten Tyroler Liedern». In dieser Erstauflage von Friese wird gemäss Hochradner «die Melodie innerhalb einiger Takte in erheblich veränderter Gestalt wiedergegeben und als Tiroler Volkslied ausgewiesen». 1832 erscheint in Steyr ein weiterer Druck, 1838 dann in einem Leipziger Gesangsbuch und 1843 in einer in Kopenhagen veröffentlichten Sammlung sowie im «Musikalischen Hausschatz der Deutschen» von Gottfried W. Fink. Diese Publikation findet auch den Weg nach Salzburg. In dieser letzten Publikation ist es nach Ansicht Hochradners vom Komponisten Gruber entdeckt worden, und er stellte «einschneidende Unterschiede» zu seiner Erstversion fest, die oft auf die lokalen Aufführungsmöglichkeiten abgestimmt waren. Gruber unternimmt vorderhand aber nichts, auch weil er dafür nicht ganz «unschuldig» ist. Er erfüllt nämlich die verschiedenen Bitten um Übersendung des Liedes bereitwillig und zeichnet das Lied selber im Verlaufe der Zeit mit minimalen Veränderungen auf.
Urheber geraten in Vergessenheit
Allmählich verblasst die Erinnerung an die Urheber von «Stille Nacht!». König Friedrich Wilhelm IV. von Preussen (1795–1861) liebt das Lied ganz besonders. Ihm ist es zu verdanken, dass man die Autoren heute noch kennt. «Stille Nacht!» wird mehr und mehr einfach als Volkslied angesehen und meist dem Salzburger Komponisten, Hof- und Domorganisten Michael Haydn (1737–1806), Bruder von Joseph Haydn, zugeschrieben. Arnsdorf war für Michael Haydn wohl Rückzugsort von Salzburg. Er komponierte dort ca. 20 Quartette.
Der König und dessen Hofkapelle haben an der Urheberschaft «Haydn» aber ihre Zweifel. Die Königlich-Preussische Hofkapelle in Berlin richtet in der Folge eine Anfrage an die Erzabtei Sankt Peter in Salzburg – ein Benediktinerkloster – mit der Bitte zur Klärung des Sachverhalts, zu Angaben über die Herkunft und eine Abschrift des Liedes. Pater Ambros Prennsteiner erinnert sich dort und ersucht, den in Hallein lebenden Komponisten Franz Xaver Gruber – bereits 70jährig und für die damalige Zeit «hochbetagt» – «die Entstehungsgeschichte des Liedes schriftlich festzuhalten und zusammen mit einer Kopie der Urschrift von ‚Stille Nacht!‘ nach Berlin zu senden».

«Stille Nacht. Heilige Nacht» Original-Niederschrift von Joseph Mohr, 1792 – 1848 (56jährig geworden) mit Tinte auf Papier um 1820 -1830 geschrieben. Im Besitz vom Salzburg Museum in Salzburg. (c) Foto: ROPO/MuA/Kulturonline.ch
Eine Originalfassung von Text und Melodie aus dem Jahr 1818 existiert heute nicht mehr. Von Franz Xaver Gruber sind vier Autographen (eigenhändige Niederschriften) erhalten. Das hier gezeigte Autograph (oben) stammt jedoch als einziges aus der Feder von Joseph Mohr. Der Liedtitel lautete damals noch schlicht «Weihnachtslied».
Die Tatsache, dass zwei Briefkonzepte für diese Dokumentation erhalten sind, zeigt, wie gewissenhaft Gruber diesem Ersuchen nachkommt. In Grubers «Authentischer Veranlassung zur Composition des Weihnachtsliedes ‚Stille Nacht!, Heilige Nacht!‘», die er handschriftlich am 30. Dezember 1854 abfasst, heisst es:
„Es war am 24ten Dezember des Jahres 1818, als der damalige Hülfspriester Herr Joseph Mohr bei der neu errichteten Pfarr St. Nicola in Oberndorf dem Organistensdienst vertretenden Franz Gruber (damals zugleich auch Schullehrer in Arnsdorf) ein Gedicht überreichte, mit dem Ansuchen eine hierauf passende Melodie für 2 Solostimmen sammt Chor und für eine Guitarre-Begleitung schreiben zu wollen. Letztgenannter überbrachte am nämlichen Abend noch diesem Musikkundigen Geistlichen, gemäß Verlangen, so wie selbe in Abschrift dem Original ganz gleich beiliegt, seine einfache Composition, welche sogleich in der Heiligen Nacht mit allen Beifall produzirt wurde“.
Vorgetragen wurde das Lied, wie es im Briefkonzept heisst,
„von dem geistl. Herrn Mohr (der ein guter Tenorist war) und dem Organisten Gruber (Bass). H. J. Mohr begleitet dasselbe mit der Guitarre. (…) Da dieses Weinachtslied durch einen bekannten Zillerthaler nach Tirol gekommen, dasselbe aber in einer Liedersamlung zu Leipzig etwas verändert erschienen ist, so beehrt sich der Verfasser, dasselbe dem Originale gleichlautend beilegen zu dürfen.“ Hallein, 30. Dezember 1854, Franz Gruber mp.
Auch in dieser «Authentischen Veranlassung» mehr als 30 Jahre nach der Komposition, erfährt man nichts über die Motive der Komposition. Diese Abschrift des Liedes von Gruber aus dem Jahr 1854 ist wie die Urschrift unauffindbar. Beide gelten als «verloren». Erhalten sind jedoch vier andere Niederschriften (Autographen) Grubers. Die Fassung von 1836 für die Halleiner Stadtpfarrkirche ist als Orchesterfassung eingerichtet. Grosse Bedeutung betr. Urheberschaft kommt auch dem ältesten erhaltene Autograph von Joseph Mohr zu, das allerdings erst am 8. Dezember 1995 (!) gefunden wurde und im Salzburg Museum (früher Salzburger Museum CarolinaAugusteum) noch heute gezeigt wird.
Dank dem wissen wir heute mit Sicherheit, dass Mohr den Liedtext bereits 1816 schuf. Das einzige «Stille Nacht!»-Autograph aus der Hand Mohr’s weist nämlich den Schriftzug «Text von Joseph Mohr mpia Coadjutor1816» auf. Die Untersuchung des Dokuments legt nahe, dass sich die Datierung «1816» auf den Zeitpunkt der Niederschrift des Textes bezieht. Das Autograph Mohrs enthält weiter die Textzeile «Melodie von Fr: Xav: Gruber»und bestätigt damit die Urheberschaft Gruber/Mohr eindeutig. Daraus und aus anderen Quellen lässt sich die verlorene Urschrift von Gruber herleiten. Noch vor dem Auffinden dieses Mohr-Dokuments ging man immer wieder davon aus, dass das Lied – Text und Melodie – spontan am Heiligabend 1818 entstanden ist, was ebenfalls ins Reich der Legenden gehört. Heiligabend gilt nur für die Vertonung. Zudem ist klar, dass Mohr der Initiant der Komposition war, denn er kam zu Gruber und bat um Vertonung.
Berühmte Interpreten – Kulturerbe der UNESCO
Zur Wende ins 20. Jahrhundert singt man «Stille Nacht!», verbreitet durch katholische und protestantische Missionare, bereits auf allen Kontinenten. Im Oktober 1905 erfolgt die erste Schallplattenaufnahme durch das US-amerikanische Haydn Quartet und «Stille Nacht!» wird zum meistverkauften Weihnachtslied weltweit. Das Lied wird sukzessive von berühmten Interpreten gesungen und auf Tonträgern festgehalten. Die Liste umfasst heute gegen 100 Namen und liest sich wie ein «Who is Who» verschiedenster Stilrichtungen: Jose Carreras, Frank Sinatra, Nana Mouskouri, Max Greger, Roger Whittaker, Udo Jürgens, Tony Marshall, Karel Gott, die Kelly Family, die Zillertaler Schürzenjäger, Andy Borg, Hansi Hinterseer, die Calimeros, und viele andere mehr.
Stellvertretend für andere seien hier nur zwei berühmte und besondere Interpreten etwas näher erwähnt, nämlich Bing Crosby (1903-1977), und die Königin des Gospels, Mahalia Jackson (1911-1972). Wenn sie mit ihrer Jahrhundertstimme, wohl für immer unerreicht, das Lied singt – die letzte Strophe nur summend –, so packt es einem auch heute noch. Mahalia Jackson sang übrigens bei der Inauguration von US-Präsident John F. Kennedy und auch beim Begräbnis von Martin Luther King und Robert Kennedy. Bing Crosby und Mahalia Jackson verkauften Tonträger von «Stille Nacht!» in zweistelliger Millionenhöhe, Bing Crosby allein etwa 30 Millionen.
1943 stellt die SchriftstellerinHertha Pauli (1906–1973) fest, dass viele US-Amerikaner das Lied «Silent Night!» für ein «US-amerikanisches Volkslied» halten. Sie schreibt darüber in den USA das Buch «Silent Night. The Story of a Song», in dem sie den eigentlichen Ursprung des Liedes darstellt.
Die UNESCO hat das Lied in die österreichische Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. «Stille Nacht! Heilige Nacht!» stehe repräsentativ für das Feiern von Weihnachten. Das Lied repräsentiere die Art, wie das Weihnachtsfest gefeiert wird. Es thematisiere den Wunsch der Menschen nach allumfassendem Frieden. «Stille Nacht!» vermittle ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und fördere den zwischenmenschlichen Austausch und das gegenseitige Verständnis, schreibt die UNESCO. Dabei könnte sie sich mit ihrer Begründung auf ein Ereignis am Heiligen Abend des ersten Kriegsjahrs 1914 berufen.

Führung im Salzburg Museum. (c) Foto: ROPO/MuA/Kulturonline.ch
«Weihnachtsfrieden» im Kriegsjahr 1914
Informationen zu «Weihnachtsfrieden 1914»!
Zu Beginn des Ersten Weltkriegs kommt es an der Westfront, im heutigen Grenzgebiet zwischen Belgien und Frankreich, zu einer Art spontanem «Weihnachtsfrieden». Dass zu Weihnachten Kampfhandlungen teilweise eingestellt wurden, konnte man zu allen Zeiten beobachten. Doch hier zwischen den Schützengräben von Deutschen, Briten und Franzosen geht es darüber hinaus. Aus mehreren Tagebucheinträgen von Soldaten und Offizieren wird oft von den Geschehnissen rund um den Ort Ypern in Flandern berichtet: Am Abend des 24. Dezember 1914 ertönt plötzlich aus den deutschen Schützengräben das Lied «Stille Nacht». Als das Lied beendet ist, applaudieren die Briten auf der anderen Seite und singen ihrerseits, worauf die Deutschen kleine geschmückte Tannenbäume auf die Schützengräben stellen. Davon gibt es Filmaufnahmen und Zeitungsberichte, etwa im Daily Mirror, wie in Arnsdorf im «Stille-Nacht!»-Museum in einem eindrücklichen Video zu sehen ist. So ergibt sich 1914 das eine und andere. Deutsche und Engländer geheschliesslich aus ihren Gräben heraus aufeinander zu und tauschen Tabak und Getränke aus. Die Aufzeichnungen berichten sogar von einem gemeinsamen Gottesdienst am Heiligen Abend. Dabei sei der biblische Psalm 23 gebetet worden: «Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen». Der britische Lieutenant Arthur Pelham Burn schreibt in sein Tagebuch:
«Die Deutschen standen auf der einen Seite zusammen, die Engländer auf der anderen. Die Offiziere standen in der vordersten Reihe, jeder hatte seine Kopfbedeckung abgenommen. Ja, ich glaube dies war ein Anblick, den man nie wieder sehen wird.»
Andere Berichte sprechen sogar von einem gemeinsamen Fussballspiel, das Engländer und Deutsche im sogenannten Niemandsland, dem Gebiet zwischen den Frontlinien, durchseucht von Leichengeruch, ausgetragen haben. Die britische Band «The Farm» hatte 1991 ihren grössten Hit mit «All together Now». Das Lied beschreibt diese Ereignisse von damals.
Am Anfang dieses Weihnachtsfriedens stand das spontane Singen von «Stille Nacht!». In der Folge werden diese «Verbrüderungseinheiten» von 1914 mitsamt ihren Offizieren versetzt und für «Verbrüderung» gilt fortan die Todesstrafe. Die Tötungsmaschinerie läuft nach Weihnachten 1914 wieder an, nachdem 1914 bereits Tausende in den ersten Monaten ihr Leben verloren hatten. Der «Grosse Krieg» mit etwa 20 Millionen Opfern dauert noch knapp vier Jahre.
Stalingrad: «Wir weinten wie die Schlosshunde»
24. Dezember 1942: Rund eine Viertelmillion deutsche Soldaten der 6. Armee sind in Stalingrad von der Roten Armee eingekesselt. Draussen eben noch Trommelfeuer der «Stalinorgeln», eisige Temperaturen, bis minus 30 Grad C, die Wolga am Zufrieren, nebst den Russen ist diese Eiszeit der zweite Feind für die Deutschen – eine Armee, die sich mit letzter Kraft wehrt. Hans Rostewitz, Offizier in der 6. Armee in einem Interview unter Tränen (zu sehen in Oberndorf): «Eine Ratte kann sich in der Erde verkriechen, kann Schutz suchen vor der Kälte, aber der Mensch kann das nicht.» Der Volksempfänger (Reichsrundfunk) überträgt Programme aus der Heimat an die Soldaten. Dann die Durchsage: «Achtung, Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad. Ich bitte euch Kameraden, in das alte deutsche Weihnachtslied ‚Stille Nacht!‘ einzustimmen.» Dann ertönt in der Weihnachts-Ringsendung dieses Lied. Rostewitz: „‘Stille Nacht!‘ in dieser aussichtslosen Situation. Niemand brauchte sich der Tränen zu schämen“, und Hans-Erdmann Schönbeck, ebenfalls Offizier der 6. Armee: «Beim Ertönen von ‚Stille Nacht!‘ weinten wir wie die Schlosshunde. (…) Es war sternenklar in jener Nacht. Wir schickten über den Mond und das Firmament gedanklich Grüsse an unsere Liebsten. Es wurde wenig geschossen an diesem Heiligabend. Die Russen liessen uns mehr oder weniger in Ruhe …»
Kurz vor Weihnachten 1942 wird Kurt Reuber zu den deutschen Truppen nach Stalingrad eingeflogen.Er ist evangelischer Pastor und zugleich Lazarett-Oberarzt. Er operiert was das Zeug hält, viele sterben in seiner Anwesenheit. Es ist Heiligabend. Er zeichnet mit Holzkohle auf die Rückseite einer russischen Karte ein Bild mit Maria und dem Jesuskind, zeigt das seinen Kameraden und stimmt mit ihnen «Stille Nacht!» an. Es seien in der Folge Russen – sogenannte «Deutschrussen» – mit weissen Lappen in den Händen zu ihnen gestossen und hätten mitgesungen, wird in Theaterstücken berichtet. Letzteres mit den Russen gehört höchstwahrscheinlich ins Reich der Legenden – könnte sein, ist aber nicht belegt –, nicht aber das mit dem Marienbild und «Stille Nacht!».Das Bild, Kind und Mutterkopf zueinander geneigt, von einem grossen Tuch umschlossen verdeutlicht die Geborgenheit und Umschliessung von Mutter und Kind. «1942 Weihnachten im Kessel – Festung Stalingrad – Licht, Leben, Liebe», steht auf dem Bild. Später fügt Reuber hinzu: «Mir kamen die Worte von Johannes in den Sinn: Licht, Leben, Liebe. Was soll ich dazu noch sagen? Wenn man unsere Lage bedenkt, in der Dunkelheit, Tod und Hass umgehen – und unsere Sehnsucht nach Licht, Leben, Liebe, die so unendlich gross ist in jedem von uns!» Reuber gerät später in Kriegsgefangenschaft und stirbt am 20. Januar 1944 im Lager an Fleckentyphus.
In einer der letzten Ju-52, die noch aus dem Kessel vom Stalingrad herausfliegt, nimmt ein schwer verwundeter Offizier das Bild mit, zusammen mit Reubers Selbstbildnis und etwa 150 weiteren Porträts. Diese gelangen zu Reubers Familie. Auf Anregung von Bundespräsident Karl Carstens übergibt die Familie die «Stalingradmadonna» am 26. August 1983 der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zur Aufbewahrung. Reproduktionen, auch Holzskulpturen, finden sich an vielen Orten in England, Deutschland, Österreich und Russland.
Das weitherum bekannte «Stille Nacht!» konnte vor allem im 20. Jahrhundert von politischen Implikationen nicht verschont bleiben. In diversen Umdichtungen wurde es zu einem Mittel der Agitation gemacht, «die von sozialkritischem Anspruch bis zur nationalsozialistischen Kampfansage reicht» (Standl). Auch der Originaltext wird in der Weihnachts-Ringsendung des Deutschen Reichsrundfunks 1942 «als Gruss der Heimat und Symbol der Zusammengehörigkeit funktionalisiert». Die kritische Situation der Wehrmacht bewog Hitler dann aber sukzessive, den Widerstand gegen «Stille Nacht!» aufzugeben und das Lied dafür für propagandistische Zwecke einzusetzen.
 Blick von der Salzach her auf die «Stille Nacht!»-Gedächtniskapelle, die auf dem Schuttkegel der abgerissenen St. Nikolaus-Kirche steht. Rechts der Wasserturm, der erhalten blieb. (c) Foto: Hans Reis.
Blick von der Salzach her auf die «Stille Nacht!»-Gedächtniskapelle, die auf dem Schuttkegel der abgerissenen St. Nikolaus-Kirche steht. Rechts der Wasserturm, der erhalten blieb. (c) Foto: Hans Reis.
Sechs Strophen im Original – drei in den Liederbüchern
Von der 1818 gesungenen Original-Version des Liedes haben es im Allgemeinen nur drei Strophen in die Liederbücher der Welt geschafft. Joseph Mohr verfasste jedoch sechs. Der junge, sehr volksnahe Priester wollte darin vor allem den Trost des Weihnachtsfestes in dieser schweren Zeit leicht verständlich in die deutsche Sprache bringen.
Vom Original werden heute in der Regel die erste, die sechste und abschliessend die zweite Strophe gesungen. Die dritte bis fünfte Strophe werden weggelassen. Die heute gebräuchliche Chorfassung geht auf den Leipziger Thomaskantor Gustav Schreck (1849–1918) zurück. Die allgemein bekannte, heute meistens gesungene Version, unterscheidet sich jedoch von der ursprünglichen Fassung textlich in folgenden Punkten:
Das Wort «Jesus» hat man durch «Christ» ersetzt. Auch ein paar ältere Formen, wie der alte Akkusativ «Jesum» und «lockigten» sind modernisiert worden. In der sechsten Strophe hat manausserdem die Zeile «Tönt es laut bei Ferne und Nah» in die etwas modernere «Tönt es laut von Fern’ und Nah» geändert. In einigen der autographen Notenblätter von Gruber, in denen die Strophen Solo-Stimmen zugeordnet sind, werden bei allen die letzten beiden Zeilen vom Chor nochmals wiederholt, also insgesamt viermal gesungen, was heute nicht mehr der Fall ist.
| Originaltext | Heute gebräuchliche Fassung | |
| Stille Nacht! Heilige Nacht! Alles schläft. Einsam wacht Nur das traute heilige Paar. Holder Knab’ im lockigten Haar, Schlafe in himmlischer Ruh! Schlafe in himmlischer Ruh! | Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft, einsam wacht Nur das traute, hochheilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar, Schlaf in himmlischer Ruh, Schlaf in himmlischer Ruh. (1. Strophe) | |
| Stille Nacht! Heilige Nacht! Gottes Sohn! O! wie lacht Lieb’ aus deinem göttlichen Mund, Da uns schlägt die rettende Stund’. Jesus! in deiner Geburt! Jesus! in deiner Geburt! | Stille Nacht, heilige Nacht! Gottes Sohn, o wie lacht Lieb aus deinem göttlichen Mund, Da uns schlägt die rettende Stund, Christ, in deiner Geburt, Christ, in deiner Geburt. (3. Strophe) | |
| Stille Nacht! Heilige Nacht! Die der Welt Heil gebracht, Aus des Himmels goldenen Höh’n Uns der Gnade Fülle läßt seh’n Jesum in Menschengestalt! Jesum in Menschengestalt! | ||
| Stille Nacht! Heilige Nacht! Wo sich heut alle Macht Väterlicher Liebe ergoß Und als Bruder huldvoll umschloß Jesus die Völker der Welt! Jesus die Völker der Welt! | ||
| Stille Nacht! Heilige Nacht! Lange schon uns bedacht, Als der Herr vom Grimme befreyt, In der Väter urgrauer Zeit Aller Welt Schonung verhieß! Aller Welt Schonung verhieß! | ||
| Stille Nacht! Heilige Nacht! Hirten erst kundgemacht Durch der Engel „Halleluja!“ Tönt es laut bey Ferne und Nah: „Jesus der Retter ist da!“ „Jesus der Retter ist da!“ | Stille Nacht, heilige Nacht! Hirten erst kundgemacht, Durch der Engel Halleluja. Tönt es laut von fern und nah: Christ, der Retter ist da, Christ, der Retter ist da! (2. Strophe) |
Gerade aus den eingangs erwähnten Zeitumständen heraus erhält der Text der vierten Strophe eine besondere Bedeutung. Diese drücke die grosse Friedenssehnsucht aus, so die Experten, welche die Menschen zur damaligen Zeit hatten.
«Stille Nacht!», eine schöpferische Eigenleistung der beiden Autoren, lässt sich weder als typisches Volkslied noch als stilisiertes Kunstlied beschreiben. Gerade diese relative Selbständigkeit ermöglicht den verschiedensten sozialen Schichten, Konfessionen und Nationen den Zugang zu diesem Lied. Für viele nicht-christliche Gemeinschaften ist es weltweit schlicht zu einem Friedenslied geworden, vor allem im blutigen 20. Jahrhundert.
«Stille Nacht!», von «einfachen» Menschen geschrieben berührt uns auch 200 Jahre später auf gleiche Art, wie es damals die Menschen in einer sehr schwierigen Zeit ergriffen hat. Heute steht dieses Lied wie kein anderes für eine ganz besondere Stimmung, die man zum einen mit dem Weihnachtsfest verbindet: Friede und Geborgenheit. Für die Ergriffenheit der Oberndorfer, von der Gruber am Heiligabend 1818 berichtet hat, sorgt nicht nur der Text, sondern wohl mehr noch dessen Vertonung. Musikanalytiker sehen das Erfolgsrezept von «Stille Nacht!» in den «selig machenden Terzen, dem wiegenden Sechs-Achtel-Takt und der schlichten harmonischen Folge von Tonika, Dominante und Subdominante». Weniger fachspezifisch formuliert, ist es einfach eine «Melodie für die Ewigkeit», die schnell im Ohr bleibt und die Herzen berührt. Das ist sicher der Grund, warum sich das Lied rasch über den ganzen Erdball verbreitet hat und gemäss Umfragen das bekannteste Musikstück der Welt ist. Weihnachten und «Stille Nacht!» gehören wohl untrennbar zusammen, nicht nur heute, sondern auch in Zukunft, solange Weinachten gefeiert wird. «Stille Nacht!» wird auch immer die Sehnsucht nach Frieden verkörpern, solange es (feindselige) Menschen gibt.
Joseph Mohr: Vom Almosenkind zum «Stille Nacht!»-Dichter
Der «Texter» von «Stille Nacht!» erblickt am 11. Dezember 1792, als viertes «lediges» (uneheliches) Kind von Anna Schoiber das Licht der Welt und wächst in räumlicher Enge und ärmlichen Verhältnissen auf. Seine Mutter, die aus einer angesehenen Familie stammt, ist durch «fleischliche Verbrechen» (mehr dazu unten) in soziale Not geraten und versucht, mit Strickarbeiten ihren Lebensunterhalt zu sichern. Der angebliche Vater ist der ausdemLungau stammende Soldat des Salzburger Militärs, Joseph Franz Mohr, seit dem 21. Juni 1792 fahnenflüchtig „und nicht mehr greifbar». Taufpate ist der letzte Scharfrichter Salzburgs, auch er einAussenseiter, aber recht vermögend.
Seine Jugendzeit verbringt Joseph Mohr in der Mozartstadt. Durch die wohlwollende Unterstützung des Domchorvikars Johann NepomukHiernle, bei dem er auch etwa 10 Jahre wohnen kann, ergeben sich für Joseph unerwartete Perspektiven. Erbekommt schon in der Schulzeit Gesangs- und Violinunterricht und ist ein begeisterter Gitarrenspieler.DankHiernle, der sein Talent früh erkennt, kann er eine Universität besuchen. Der aufgeweckte Schüler mit hervorragenden Noten zeigt baldgrosses Interesse an der Musik und tut sich als Sänger und bei Aufführungen des Lyzeums und des Benediktinerklosters St. Peter in Salzburg hervor. Nach Studienabschluss – von 1808 bis 1810 Philosophie, bis zur Priesterweihe am 21. August 1815 Theologie – wird er «Weltpriester» und verschiedenen Pfarreien des Landes zugeteilt.Seine Vorgesetzen urteilen anfänglich über ihn wie folgt: «Sein Wesen ist noch jugendlich, unbesonnen, hingebend –purschenmässig geht er mit der langen Tabakpfeife, den Beutel an der Seite, über die Gassen», so Pfarrprovisor Georg Heinrich JosephNöstler am 5. Oktober 1818 in einem Beschwerdebrief an das Konsistorium in Salzburg. Auch scherze er mit dem anderen Geschlecht und singe in den Wirtshäusern ungebührliche Lieder.
Die ersten Stationen führen Mohr nach Ramsau bei Berchtesgaden und Mariapfarr im Lungau, der Heimat seines angeblichen Vaters. Doch dasrauhe Klima dort behagt dem schwächlichen Mohr nicht. Der aus Mariapfarr gebürtige Pfarrprovisor Joseph Kessler ersucht um Versetzung, und Mohr wird per 18. Oktober 1817 als «Coadjutor der Pfarre St. Nikola in Oberndorf bestellt». Von 1817 bis 1819 wirkt er da als Hilfspriester – von dort die Kritik (und Feindschaft) Nöstlers. Die weiteren zahlreichen Stationen seines Lebensweges bringen Mohr nachKuchl, Golling,Vigaun, Anthering, Eugendorf und Hof. Mit seiner Versetzung von Oberndorf nach Kuchl enden auch die Auseinandersetzungen mitNöstler in Oberndorf. Ein Grund für die oftmalige Versetzung des jungen Priesters ist weniger in der Dienstbeschreibung als vielmehr in seinem schlechten Gesundheitszustand zu suchen. Ein ärztliches Zeugnis vom 17. August 1824 hält bei ihm «eine wohl erblich bedingte Anlage zur Lungenschwindsucht» fest. Ab 1827 verwaltet er in Hintersee selbständig (als Vikar) eine «Pfarre». 1837 übersiedelt er nach Wagrain, wo er sich durch seine «hervorragende seelsorgerische Arbeit» auszeichnet. Der Bau eines Schulhauses geht auf seine Initiative zurück, ebenso der Aufbau der Armenpflege. Mohr stirbt 56-jährig am 4. Dezember 1848 an den Folgen einer Lungenlähmung.
Aus heutiger Sicht kann Joseph Mohr als fortschrittlicher, leutseliger Priester angesehen werden, währendNöstler ein Traditionalist war. Das führte zu Konflikten. Was die vonNöstler kritisierten Wirthausbesuche betrifft, war die fehlende Pfarrköchin ein Grund – ausKostengründen abgelehnt. Deshalbass Mohr oft auswärts, was ihm den Kontakt zu den Schiffern erleichterte und ihn über deren Neuigkeiten, aber auch deren Sorgen ins Bild setzte. Mohr hat lange unter seiner Herkunft gelitten: Vaterlos und eine «Hure» als Mutter, für die es in Salzburg keinen Platz gab. Er habe deshalb gelegentlich auch seine Herkunft verschwiegen, vielleicht sogar verleugnet. Für Gurnter ist es nicht ausgeschlossen, dass das Gedicht «Stille Nacht!» auf Mohr wie eine Art «Befreiungsschlag» wirkte.
Franz Xaver Gruber: Vom Weber zum Lehrer und Komponisten
Der Komponist von «Stille Nacht!» erblickt am 25. November 1787 als Sohn einer Leinenweberfamilie in Hochburg (Oberösterreich) das Licht der Welt. Wie sein Vater sollte auch er als fünftes von sechs Kindern den Beruf des Webers erlernen, was er auch bis zu seinem 18. Lebensjahr tut. Davon konnte man allerdings schlecht leben. Wie Joseph Mohr wäre Gruber ohne das Engagement eines Gönners kaum zu höherer Bildung gelangt. Andreas Peterlechner, Schulmeister des Ortes, erkennt bald die Begabung seines Schülers, sein musikalisches Talent und erteilt ihm Musikunterricht.Gruber beginnt bereits als Elfjähriger mit dem Orgelspiel. Zudem überredet Peterlechner den Vater des jungen Gruber, dem Buben die Ausbildung zum Lehrer zu ermöglichen.
Vermutlich erwirbt er sich bei Peterlechner die Grundlagen zum Volksschullehrer und legt 1806 in Ried im Innkreisdie Prüfung dafür ab. Im folgenden Jahr wiederholt er sie in Salzburg, um auch hier die Lehrbefugnis zu erhalten. Seinen ersten selbständigen Dienst tritt er am 12. November 1807 in Arnsdorf an. Weil das Gehalt sehr karg ist, bessert er es mit Messner- und Organistendiensten auf. Bereits früh beginnt er zu komponieren, als vermutlich erstes Werk (1804) ein «Predigtlied auf die heilige Fastenzeit». Bei Georg Hartdobler, einem begnadeten Organisten, Musiklehrer und Schüler von Michael Haydnim bayerischen Burghausen, erhält Gruber in den Jahren 1805 und 1806 Orgelunterricht. Gruber dürfte die sieben Kilometer von der Steinpointsölde in Hochburg in die Stadtmitte von Burghausen an jedem Unterrichtstag zuFuss gegangen sein. Der Unterricht erfolgt auf der einmanualigen Orgel der Stadtpfarrkirche St. Jakob mit 15 Registern, 1717 vom Salzburger Orgelbauer Johann ChristophEgedacher gebaut.
Viele seiner ins Arnsdorf entstehenden Werke sind für bestimmte Anlässe gedacht. Nebenbei übernimmt er von 1816 bis 1829 den Kantoren- und Organistendienst in der Kirche St. Nikolaus in der «Pfarre» Oberndorf. Eigentlich will er dort auch Lehrer werden, aber das bleibt unerreicht, weil die Benediktinerabtei vonMichaelbeuern, zu der die Schulevon Arnsdorfgehört, keine Freigabe erteilt. Auch die 1827 freigewordene Messnerstelle in St. Nikolaus Oberndorf erhält Gruber nicht. Darauf kündigt er seinen Dienst und bewirbt sich 1829 erfolgreich als Lehrer und Messner in Berndorf. Sein Arbeitszeugnis bescheinigt Grubers «pädagogisches Talent». Als ihm die Stelle eines Chorregenten und Organisten an der Stadtpfarrkirche Hallein angeboten wird, zögert er nicht lange. Er sieht darin seine Berufung als Musiker bestätigt, und ab dem Zeitpunkt seiner Ernennung (2. Juli 1835) bildet die Musik das Zentrum seines Wirkens. Diese Chorregentenstelle verhilft ihm zu entsprechendem Ansehen in der Bürgerschaft. Hier kann er sich während fast 30 Jahren – bis zu seinem Tod – als Chorregent,Choralist und Organist ganz seinem Lieblingsthema, der Musik, widmen. Grubers musikalisches Schaffen mit über 90Werken steht fastausschliesslich im Dienst der Kirche. Er stirbt am 7. Juni 1863 im damals hohen Alter von fast 76 Jahren an Altersschwäche. Gruber war dreimal verheiratet. Seine beiden ersten Frauen, die erste viel älter – die Witwe seines Lehrer-Vorgängers – die zweite (eine Schülerin) viel jünger schenken ihm insgesamt 12 Kinder. Der ersten Ehe entstammen zwei Kinder, beide sterben, ebenso die Mutter, 10 Jahre nach der Geburt des zweiten Kindes (1825). Der zweiten Ehe entspringen zehn Kinder, von denen aber nur vier erwachsen werden. Diese Frau stirbt bei der Geburt des 10. Kindes. Gruber trägt nebst seinen beiden ersten Frauen insgesamt acht von zwölf eigenen Kindern zu Grabe …
«Der Kaiser braucht Soldaten»
Wenige Wochen nach Schulbeginn des Jahres 1807 klopft es in Arnsdorf an der Klassentür der einklassigen Volksschule. Ein Bote bringt Franz Xaver Gruber den Einberufungsbefehl: «Der Kaiser braucht Soldaten» (für die Kriege Napoleons; Red.). Gruber, aus dem Innviertel stammend, sollte zu den Österreichern einberufen werden. Dieser eilt zum Abt vonMichaelbeuern, zu dem Arnsdorf als Patronatsschule gehört. Der Abt empfängt ihn sogleich, hört sich an, was Gruber vorzubringen hat und klopft ihm auf die Schulter: «Ja, Schulmeister, da machen wir uns kein Sorgen!» Der Abt schreibt einen Brief an das PfleggerichtWildshut, in dem er Gruber als «Klosterbediensteten» erklärt. Gruber wird freigestellt und muss nicht einrücken. Vermutlich wäre er, falls er überlebt hätte, nicht nach Arnsdorf zurückgekehrt und dann wäre auch «Stille Nacht!» wohl kaum entstanden.
Das Stigma «lediges» Kind
Als die Mutter von Joseph Mohr, Anna Schoiber, drei Jahre nach dessen Geburt wieder schwanger wird und ein viertes «lediges» (uneheliches) Kind zur Welt bringt, wird diese Geburt im behördlich vorgeschriebenenFormikationsprotokoll vom 3. Februar 1796 wie folgt registriert:«AnnaSchoiberin …ernähre mich mit Handarbeit, und nieinnegelegen (eingesperrt), zeige mich an, dass ich mit Felix Dreithaller Tagwerker allhier… fleischlich verbrochen habe und schwangersey. Dies ist mein viertes Verbrechen… das dritte Verbrechen geschah vor drei Jahren mit dem Soldat Jos. Mohr, der von hier desertierte. Das Kind ein Knab lebt und hat von gemeinen Almosenwöchentlich 30 Kreuzer. Ich bin wegen meinem dritten Verbrechen nie abgestraft worden. Worauf sie mit Vorbehalt der Strafe entlassen worden.»
Damals warausserehelicher Geschlechtsverkehr gesetzlich verboten. Mütter von unehelichen Kindern wurden bestraft, Selbstanzeigen wie die obige von Anna Schoiber wirkten strafmindernd. Uneheliche Kinder waren mit dem Makel der Illegitimität behaftet und deren Mütter lebten als «Huren» am Rande der Gesellschaft.

Das «Stille Nacht!»-Museum in Oberndorf. (c) Foto: Hans Reis.
Würdevolle Erinnerung am Ort des Geschehens
Oberndorf und Arnsdorf erinnern sehr stilvoll und würdig an die berühmten Söhne Gruber und Mohr, auch jetzt, zum 200-Jahr-Jubliäum von «Stille Nacht!». Es fehlen an diesen Orten (glücklicherweise) Pomp und Kitsch. Das vor zwei Jahren eröffnete «Stille Nacht!»-Museum in Oberndorf überzeugt mit einer sehr inhalts-, und facettenreichen Darstellung aller Aspekte rund um «Stille Nacht!». Gleiches gilt auch für das ältere, gleichnamige Museum in Arnsdorf, wo etwas mehr das Leben von Gruber als Lehrer im Zentrum steht. So sind dort, wo er unterrichtete und auch wohnte, beispielsweise noch sein Pult, aber auch Zeugnisse und andere Schriftstücke von ihm ausgestellt.
Am 24. Dezember findet jedes Jahr auf dem «Stille Nacht!»-Platz in Arnsdorf um 16.30 Uhr die Gruber-Mohr-Gedenkfeier statt, der ab 17.00 Uhr ein Fackelzug und Gedenkgang auf dem historischen Gruber-Mohr-Weg nach Oberndorf folgt. Mit den besten Wünschen für eine friedvolle Weihnacht verabschieden sich dort die Teilnehmenden am «Stille Nacht!»-Platz im «Stille Nacht!»-Bezirk nach dem gemeinsamen Singen des berühmten Liedes.
Speziell in diesem Jubiläumsjahr finden in Oberndorf und anderswo zahlreiche Jubiläumsveranstaltungen statt, so auch das seit 10 Jahren existierende «Stille Nacht!»-Historienspiel mit der Entstehungsgeschichte. Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren können in Arnsdorf eine Schulstunde von damals erleben, inszeniert von der Theatergesellschaft Holzhausen und erfahren dadurch viel über die damalige Zeit. Die SchauspielerinYarina Gurtner erzählt in ihrem Stück «Himmel für Anna» vor allem das Leben der Anna Schoiber (Mutter von Mohr) nach, mit gekonnt inszenierten Parallelen und Unterschieden zur heutigen Zeit, so etwa am 16. November im OFF-Theater in Salzburg. Eine Idee, die von ihrem Vater Max Gurtner stammt.